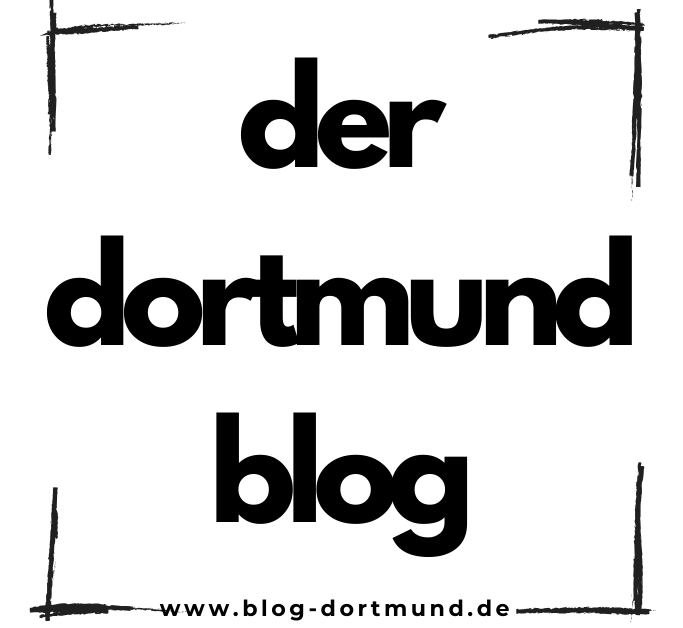Zuletzt aktualisiert am 27. August 2025
Dortmund verändert sich sichtbar. Der Strukturwandel, der mit dem Ende des Steinkohlebergbaus begann, hat die Stadt nicht gelähmt, sondern zu neuen Wegen motiviert.
Heute entstehen auf früheren industriell genutzten Flächen urbane Lebensräume, die einen starken Fokus auf Aufenthaltsqualität, Nachhaltigkeit und soziale Vielfalt legen.
Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept, kurz ISEK, bildet dabei eine zentrale Grundlage. Es setzt vor allem auf Innenentwicklung, also auf die Nutzung bestehender Flächen im Stadtgebiet, bevor neue Gebiete erschlossen werden.
Besonders im Hafenareal oder in der Nordstadt zeigt sich, wie dieses Konzept in konkrete Projekte übersetzt wird.
Alte Flächen für neue Möglichkeiten
Leerstehende Hallen, brachliegende Grundstücke oder ungenutzte Immobilien rücken in Dortmund zunehmend in den Fokus.
Besonders im Bereich des nördlichen Stadthafens werden immer mehr ehemalige Lager- und Industrieflächen in Wohn- und Arbeitsräume umgewandelt. Die Speicherstraße wird zum Beispiel als Zukunftsstandort für Bildung, Kultur und Innovation gestaltet.
Im Zuge solcher Veränderungen lässt sich in der Regel nicht auf eine professionelle Vorbereitung verzichten. Bei lange leerstehenden oder ehemals gewerblich genutzten Objekten gehört so eine professionelle Entrümpelung in Dortmund oft zu den ersten Schritten, um den Weg für sichere und nutzbare Räume freizumachen. Von dieser profitieren jedoch natürlich nicht nur gewerbliche Objekte, sondern auch Privathaushalte.
Durchmischte Nachbarschaften sind das Ziel
In Dortmund wird aus stadtplanerischer Perspektive darauf hingearbeitet, dass verschiedene Bevölkerungsgruppen gemeinsam in einem Quartier leben. Dabei geht es nicht nur um eine Durchmischung hinsichtlich des Alters oder des Einkommens, sondern auch um unterschiedliche Lebensrealitäten und kulturelle Hintergründe.
Ein Beispiel dafür stellt das Wohnquartier auf Phoenix West dar. Dort entstand auf dem Gelände des ehemaligen Hochofens ein vielseitiges Viertel mit gefördertem Wohnraum, Eigentumswohnungen und Mietangeboten. Durch diese Vielfalt soll langfristig ein stabiles soziales Gefüge entstehen, das den Charakter des Quartiers prägt.
Im Unionviertel wiederum greift das Förderprogramm „Soziale Stadt“. Dieses zielt darauf ab, bestehende Strukturen zu stärken und gleichzeitig Raum für neue Impulse zu lassen. Das Ziel ist nicht die Verdrängung, es geht um die Entwicklung von innen heraus.
Dortmunder Infrastruktur mit Zukunft
Parallel zu den baulichen Entwicklungen investiert Dortmund in seine Infrastruktur. Der modernisierte Hauptbahnhof mit barrierefreiem Zugang ist ein gutes Beispiel dafür. Auch die Erweiterung des Radwegenetzes und die bessere Anbindung einzelner Stadtteile an den öffentlichen Nahverkehr zeigen: Die Stadt will ihre Quartiere in Zukunft besser miteinander verbinden.
Die Entwicklung der Speicherstraße gehört in diesem Kontext zu den bedeutendsten Projekten. Der geplante „Smart Rhino“-Campus soll mittelfristig Bildungsinstitutionen, Kreativwirtschaft und Start-ups in einem Quartier zusammenbringen. Dadurch entsteht eine neue Verknüpfung zwischen Wohnen, Arbeiten und Freizeit.
Wichtige Grundlage: Beteiligung
Ein zentrales Merkmal vieler aktueller Projekte in Dortmund besteht in einer frühzeitigen Beteiligung der Bevölkerung.
Die Zukunftswerkstatt Innenstadt ist eines der Formate, bei denen sich die Bürger:innen aktiv einbringen können. Auch bei der Entwicklung ehemaliger Industrieareale wie dem Hoesch-Gelände wurden die Anwohnenden von Beginn an einbezogen.
Solche Prozesse tragen maßgeblich dazu bei, Akzeptanz für Veränderungen zu schaffen und die lokalen Bedürfnisse schon frühzeitig zu berücksichtigen. Gerade in gewachsenen Vierteln mit einer starken Identifikation ist das entscheidend für die nachhaltige Entwicklung.
Dortmund bleibt in Bewegung
Dortmund steht nicht still. Die Stadt nutzt ihr industrielles Erbe, um neue Perspektiven zu schaffen. Alte Gebäude werden nicht einfach abgerissen, sondern erhalten im Rahmen neuer Nutzungskonzepte eine zweite Chance.
Die Infrastruktur, soziale Programme und kreative Zwischennutzungen greifen dabei ineinander. Der Wandel ist vielerorts bereits sichtbar. Quartiere wie das Unionviertel, Teile der Nordstadt oder das Areal rund um Phoenix West zeigen, wie neue Impulse zu mehr Lebensqualität führen können.
Entscheidend ist dabei stets ein ganzheitlicher Blick auf die bauliche Substanz, die sozialen Strukturen und den Willen zur Mitgestaltung. Die Entwicklung bleibt somit eine Aufgabe auf vielen Ebenen. Doch Dortmund zeigt immer wieder, wie ein Stadtwandel gelingen kann, wenn er gemeinsam gestaltet wird.
Hinweis
Dieser Artikel enthält werbliche Inhalte und Verlinkungen zu externen Partnerseiten.
Bild von Peggy und Marco Lachmann-Anke auf Pixabay